Ergebnis im „Wisch“-Vergleich mit dem Tagesspiegel
Im gedruckten FAZ-Feuilleton vom 14.7.2010 berichtet Julia Lauer unter dem Titel Du sollst dir kein Bildnis machen von einer Tagung des Berliner Zentrum für Antisemitismusforschung an der TU Berlin über „Antiziganismus“ (9. und 10.7. [Programm – pdf]). Als Besucher und Referent dieser Tagung kann ich einige Punkte an Lauers Kritik teilen (dichtes Programm, wenig Zeit für Diskussion). Was ich nicht teilen kann, ist ihre Argumentation gegen den Eröffnungsvortrag von Wolfgang Benz:
Als Beleg für den anhaltenden Rassismus führte Benz einen Reisebericht der „Süddeutschen Zeitung“ an, dessen Autor Roma-Frauen als im Jammerton bettelnd und in knallig bunte Röcke gekleidet beschreibt. Unbestritten gibt es auch hierzulande Rassismus, gerade vorige Woche forderte die NPD die Abschiebung kosovarischer Roma aus Mecklenburg-Vorpommern mit Verweis auf deren kulturelle Fremdheit. Was aber den Zeitungsartikel betrifft, so ist schwer zu beweisen, dass die Wahrnehmung des Autors vom Klischee determiniert wird. Benz zieht gar nicht erst ins Kalkül, dass Klischees in der Erfahrung Bestätigung finden. Und sind Klischees wirklich per se rassistisch?
Wolfgang Benz wollte gar nicht die Wahrnehmung des Autors „beweisen“, sondern auf eine Tradition von Beschreibungen aufmerksam machen. Er verdeutlichte in seinem Vortrag sehr gut, dass der SZ-Artikel in der Tradition jener Reiseberichte steht, die „zivilisierte Europäer“ in den vergangenen Jahrhunderten über ihre Besuche bei „wilden Völkern“ anfertigten.
Das Problem in der Argumentation Lauers ist meines Erachtens ihre Definition von Rassismus. Die NPD bekennt sich offen zu ihren rassistischen Positionen, da hat man schnell sogenannte „Beweise“. Die Wesensmerkmale rassistischer Konstruktionen, wie sie Benz an der SZ exemplarisch zeigte, sind aber keine „beweisbaren“ Bekenntnisse, sondern jahrhundertealte und immer wiederkehrende Beschreibungsmuster bzw. Beschreibungsprioritäten. Der Autor des SZ-Artikels mag „bunte Röcke“ und „Jammerton“ tatsächlich vernommen haben – wesentlich ist aber die zentrale Stellung, die er diesen Äußerlichkeiten in seinem Reisebericht zukommen lässt. Sie verraten uns nichts über die beschriebenen Menschen in „bunten Röcken“, aber über den Blick und die Prioritäten des Autors.
Schwarze wurde im vergangenen Jahrhundert in den USA oder Europa von den meisten Weißen nicht als ebenbürtige Individuen ernstgenommen, da sie mit ihrer „kaffeebraunen“ oder „schwarzen Haut“, „Kräusellocken“, „großen Kulleraugen“, mal als Bedrohung, vielleicht mal als Opfer – fast immer als soziales „Problem“ – aber insgesamt eben reduziert auf bestimmte Attribute und damit nicht als Teil eines „Wir“ wahrgenommen wurde. Und es ist nichts anderes, wenn im Zentrum der Beschreibungen über Roma ihre „Wildheit“, ihre „bunten Röcke“, „Geheimsprachen“, „Jammertöne“ etc. stehen.
Rassismus lebt von der Ausblendung des Individuums zugunsten von „schwarzer Haut“ und „bunten Röcken“. Die NPD kann als Beispiel für bekennenden Rassismus herhalten, aber um den alltäglichen Rassismus wahrzunehmen, sollten wir auf uns selbst und unser eigenes Umfeld blicken.
 Der „Wisch“-Vergleich zeigt: FAZ und Tagesspiegel stehen sich in nichts nach.
Der „Wisch“-Vergleich zeigt: FAZ und Tagesspiegel stehen sich in nichts nach.
Rassismus in der Presse ist lange nicht auf das von Wolfgang Benz angeführte Beispiel in der SZ beschränkt. Ausgerechnet die FAZ, für die Julia Lauer schreibt, bietet ein sehr bedenkenswertes journalistisches Exempel: Vier Tage vor ihrem Artikel zur „Antiziganismus“-Tagung, nämlich am 10.7.2010, erschien in der FAZ der Artikel Wisch und Weg. Diesen Titel hat sich Maximilian Weingartner für die FAZ offenbar beim Berliner Tagesspiegel geborgt. Die Aufmachung auch: Unter dem Titel begegnet dem Leser eine bunt bekleidete Frau beim Putzen einer Autowindschutzscheibe. In welchem Verhältnis diese fotografierten Frauen zu den Artikeln stehen ist unklar, sie werden weder erwähnt noch zitiert. Sie dienen der Verbildlichung des Wortes „Scheibenputzer“ – als Individuen werden diese Frauen von den Autoren in FAZ und Tagesspiegel nicht wahrgenommen.
Derartige Abbildungen von Menschen, reduziert auf äußerliche Signal-Merkmale, dienen den Lesenden als vermeintlich spezifische Assoziationen für die, je nach Bedarf, beschriebene Gruppe. Hier sind es (in zwei voneinander unabhängigen Tageszeitungen und dennoch in nahezu identischer Weise) scheibenputzende Frauen in farbenfroher Kleidung auf Fotos für Artikel über „die Roma“. Andere Autoren benutzen vielleicht einen Mann mit Kipa in einem Artikel über israelische Außenpolitik oder einen Mann mit Turban in einem Artikel über Terrorismus. Diese Fokussierung auf Attribute, Äußerlichkeiten und Verbildlichungen ist ein Problem, das beim Verweis auf den offenen NPD-Rassismus unbeachtet bleibt. Denn ja: es gibt Roma mit Röcken, Israelis mit Kipas und Terroristen mit Turbanen. Das Problem entsteht aber mit der Reduzierung auf ebensolche Attribute bzw. mit den auf diese Attribute zurückgeführten Eigenschaftszuschreibungen – und daraus resultierenden Gruppenwahrnehmungen.
Kontextlose Fotos, die nur der Symbolik dienen, prägen sich bei den Lesenden ein. Ein bekanntes, immer wieder reproduziertes Beispiel ist das Portrait einer Figur mit großer Nase, die „den Juden“ mit „Hakennase“ stellvertretend für eine Gruppe verbildlichen soll.
Auch Begriffe und Attribute können in Bezug auf Gruppen geprägt werden, wenn sie in Beschreibungen über diese wiederholt auftauchen. Im FAZ-Artikel von Maximilian Weingartner taucht, ebenso wie im Tagesspiegel, das Wort „Kolonne“ als Betitelung für die beschriebenen Roma auf (FAZ: „Putzkollonne“, Tagesspiegel: „Scheibenwischerkolonne“). Dieser Begriff hat eine bedrohliche Konnotation, die im Zusammenhang mit den beschriebenen Menschen auf die Lesenden wirkt.
Weingartners Artikel ist außerdem exemplarisch für eine beobachtende Berichterstattung. Die beschriebenen Menschen werden dabei aus der Sicht anderer Menschen, aus der Distanz, mit nur minimaler Annäherung wahrgenommen. Neben verschiedenen Berliner Lokalpolitikern oder dem Polizeisprecher („Wir greifen nur ein, wenn es konkrete Beschwerden gibt, und die haben zugenommen“) zitiert Weingartner immerhin auch ein Mitglied der „Putzkolonne“:
„Es ist immer halb-halb. Manche Leute sind nett, andere böse“, sagt Santino in schlechtem Deutsch.
Wie viele Stunden Recherche in dieser Annäherung an „Santinos“ Leben stecken, weiß ich nicht. Statt weiterer Details über die Hintergründe hält der Autor offenbar seine eigenen Beschreibungen über die Menschen für erwähnenswert:
Santino hat einen wachen, frechen Blick, sein älterer Cousin Pepe guckt böse, der jüngste, Goldi, jugendlich unbekümmert.
Nein, das ist kein Schulaufsatz zum Thema „Beschreibe deine Haustiere“, sondern die FAZ mit einem ganz normalen Artikel über Roma. Nach seiner Expedition zum Kottbusser Tor kann der Autor auch die Überlebensstrategien der Kinder präzise schildern:
Seine Masche: Mitleid erwecken. Nicht seine Ausrüstung, also Wischer und Eimer, ist sein Kapital, sondern sein Lächeln, sein ärmliches Aussehen, seine traurigen Augen. Santino weiß, wann er traurig schauen muss und wann fröhlich.
Die beobachtende Haltung ist symptomatisch für derartige Beschreibungen. Der Autor weiß, was die Beobachteten denken, wie sie handeln und warum. Er beobachtet diese Menschen wie Tiere im Zoo und versorgt die Lesenden mit seinen Entdeckungen.
Meiner Meinung nach wissen Autoren, die für den Tagesspiegel und die FAZ schreiben, was sie tun. Sie wissen, dass sie ein Publikum haben, wenn sie das Lächeln von einen Tag lang beobachteten, „schlecht Deutsch“ sprechenden Kindern analysieren. Sie wissen, dass sie die gleichen Beobachtungen an allen Menschen der Welt oder an sich selbst machen könnten. Sie wissen auch, dass ein längeres Gespräch einschließlich Dolmetscher und eine Reise für die Hintergrundrecherche zu einem differenzierteren Ergebnis führen. Die Frage ist, ob man sich wirklich differenziert mit Menschen wie „Santino“ auseinandersetzen möchte. FAZ und Tagesspiegel haben sich in je einem Artikel identisch entschieden: „Wisch und weg“.
____
¹ Zur Kritik am Begriff vgl. z.B. Demirova, Filiz: „Wer spricht in der Antiziganismusforschung“.
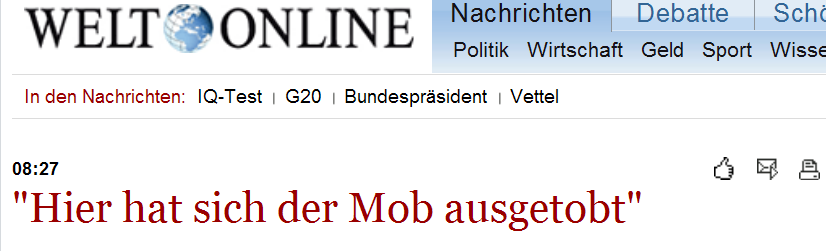
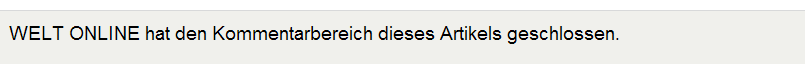
 Screenshot aus dem Video: Nach den Knüppelschlägen des Polizisten liegt der Mann am Boden. Die zwei Polizisten halten dessen Freunde von ihm fern. Der am Boden Liegende bekommt noch weitere Schläge im Verlauf des Videos. Er fragt den Beamten, warum er ihn mit dem Knüppel schlägt. Die Jugendlichen hinter der Kamera bitten die Polizisten, aufzuhören. Ohne Erfolg. (via
Screenshot aus dem Video: Nach den Knüppelschlägen des Polizisten liegt der Mann am Boden. Die zwei Polizisten halten dessen Freunde von ihm fern. Der am Boden Liegende bekommt noch weitere Schläge im Verlauf des Videos. Er fragt den Beamten, warum er ihn mit dem Knüppel schlägt. Die Jugendlichen hinter der Kamera bitten die Polizisten, aufzuhören. Ohne Erfolg. (via