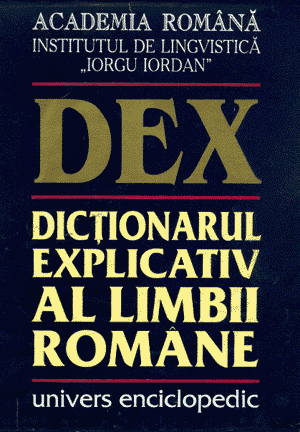Sommerinterview mit Herrn Prof. Dr. Reinhold R. Grimm (Juni 2007): Der Jenaer Romanist und Vorsitzender des Akkreditierungsrates äußert sich zu den aktuellen Entwicklungen in der deutschen Hochschulpolitik.
Univ.-Prof. Dr. Reinhold R. Grimm besetzt an der Friedrich-Schiller-Universität Jena den Lehrstuhl für romanische Literaturwissenschaft (Französisch und Italienisch).
In diesem Sommerinterview interessierten uns neben einigen perspektivischen Ausblicken zur Romanistik in Jena überwiegend die Vorstellungen, die Herr Grimm mit dem Bologna-Prozess verbindet. Herr Grimm ist Vorsitzender des Philosophischen Fakultätentages, Präsident des Allgemeinen Fakultätentages, Stellvertretender Vorsitzender des Universitätsrates der Universität Wien und seit Mai 2007 Vorsitzender des Akkreditierungsrates.
Das Interview führten im Namen des Fachschaftsrats Romanistik Jena:
Marcelo Cordeiro Correia da Silva und Hendrik Kraft.
Publiziert auch im Blog des FSR Romanistik Jena
FSR: Sie wurden in den Fluren dieses Instituts einmal als „großer Geist“ bezeichnet, …
Grimm: Das muss ein Irrtum sein.
FSR: … gemeint im Sinne einer klassischen humanistisch-philologischen Tradition. Bedeutet der Transformationsprozess, unter dem wir momentan leiden, auch den Tod des „Humanisten“, bzw. ist noch Raum da, um an deutschen Universitäten zukünftig „große Geister“ hervorzubringen?
Grimm: Ich bin gar nicht so sicher, ob die Universitäten die Aufgabe haben, „große Geister“ auszubilden, wahrscheinlich entstehen die „großen Geister“ in jeder Art von Organisation, ganz unabhängig. Ich möchte, dass es die Geisteswissenschaften, die mich wirklich faszinieren, auch in den nächsten Generationen noch gibt. Und dass die Universitäten nicht zu einem technokratischen Ensemble von Studiengängen verkommen, die man angeblich unmittelbar benutzen kann. Aber es wird die Geisteswissenschaften und die Philologien nur weiterhin geben, wenn sie sich ändern. Das klingt zwar ganz banal, ist aber wirklich so. Und deshalb bin ich ganz entschieden für den Bologna-Prozess und für strukturelle Änderungen auch in der Lehre, und zwar nicht, weil dieses neue System unbedingt für alle Ewigkeiten besser ist, sondern weil es mich und meine Kolleginnen und Kollegen zwingt, darüber nachzudenken, was wir machen und warum wir das machen. Außerdem bin ich der Meinung, dass eine so große Institution wie die Universität sich nicht von innen heraus reformiert und ändert, sondern nur auf Druck von außen.
Im Übrigen, die „großen Geister“ und das, was Sie Humanismus nennen, kann man nicht an einer bestimmten Studienform festmachen, oder daran, dass alle das große Latinum haben.
FSR: Aber wenn man am Grundsatz der traditionellen deutschen Universität ansetzt, nur Forum oder Medium als Anregung zur Bildung durch Selbstbildung zu sein, ist dieser noch vereinbar mit der neuen …
Grimm: Sie meinen mit der mutmaßlichen Verschulung des Unterrichts?
FSR: Ja.
Grimm: Also ich würde das von einer anderen Seite angehen. Als ich anfing zu studieren, machten 22% der Bevölkerung Abitur. Heute sind es annähernd 40% und wir wollen ja auch, dass mehr als 40% auf die Dauer Zugang zur höheren Bildung haben. Das Publikum, das wir an der Universität haben, hat ganz verschiedene Interessen. Die Universität muss sich daran gewöhnen, dass es auch Studierende gibt, die sich mit einem Bakkalaureus begnügen und ihren Bildungshorizont erweitern wollen, um dann in ein Berufsfeld zu gehen, das wir gar nicht so genau voraussehen. Und es gibt daneben auch die anderen, die ein traditionelles wissenschaftlich orientiertes Studium machen wollen und andere Berufspläne haben. Für beide ist die Universität da.
FSR: Als Mitglied des Allgemeinen Fakultätentages haben Sie sich Ende der 90er Jahre gegen den Bologna-Prozess nicht nur geäußert, sondern engagiert. An welchem Punkt wurde Ihnen klar, Sie sind nicht mehr dagegen?
Grimm: Das war ein Prozess, nicht nur für mich allein, für die Fakultätentage insgesamt. Für mich gab es mehrere Motive; Zum einen stellte ich fest, mit welchen läppischen und konservativen Argumenten gegen den Bologna-Prozess polemisiert wurde, ich bemerkte da auch Schutzhaltungen. Und das zweite waren konkrete Erfahrungen. Ich wurde von der Akkreditierungsagentur ACQUIN mehrfach eingeladen, an Kommissionen, Begehungen und Studiengangsbeurteilungen mitzumachen und habe so erfahren, wie großartig das ist, wenn ein Fach gezwungen wird nicht mit einer ›Obrigkeit‹, sondern mit Peers ausführlich eine Woche lang zu diskutieren, was es macht, warum es das macht, was fehlt, was nicht fehlt. Und das Dritte war die Erfahrung der Evaluierung meines Fachs in Jena, die im Rahmen der Universitätspartnerschaft Jena-Leipzig-Halle stattfand. Ich fand das eine unglaublich gute Erfahrung, dass wir gruppenweise, also die Professoren unter sich, der Mittelbau unter sich, dann auch die Studierenden, uns zum ersten Mal darüber unterhalten mussten, was wir eigentlich machen. Dabei machte ich ganz verblüffende Feststellungen, z.B. dass meine Kollegen gar nicht der Meinung waren, dass ich so großartig prüfe, wie ich immer dachte, und umgekehrt. Wir haben uns über Inhalte unterhalten, wochenlang. Ich fand das eine äußerst positive Erfahrung. Allerdings eine, die keine Konsequenzen hatte. Wir haben uns dann zusammengesetzt, einen Entwicklungsplan geschrieben und der damaligen Universitätsleitung Vorschläge für die weitere Entwicklung gemacht. Also: entweder die Breite der Romanistik erhalten oder die kleinen Fächer stärken, Rumänistik und Lusitanistik zum Beispiel. Das ist leider im Nichts versackt. Und das darf eben nicht sein.
FSR: Was hat es mit dem neuen Akkreditierungssystem auf sich?
Grimm: Früher wurden Studiengänge vom Ministerium genehmigt oder nicht genehmigt. Dafür gab es bundesweit einheitliche Rahmenrichtlinien, die von der Kultusministerkonferenz gemeinsam mit den Fakultätentagen festgelegt wurden. Jetzt werden Studiengänge nicht mehr von den Ministerien, sondern im Akkreditierungsverfahren überprüft. Die anbietenden Fächer sind jetzt selbst mehr gefordert.
FSR: Existiert Orientierungslosigkeit unter Studierenden und Lehrenden gegenüber diesen neuen Herausforderungen?
Grimm: Die Studierenden sehen zunächst nur die Verschulung und die Reglementierung, die eigentlich nicht sein müsste, wenn man die Bologna-Vorgaben korrekt anwendete. An sich müsste man die Module so ausgestalten, wie wir das auch im Akkreditierungsrat wollen, dass Studierende eher mehr Möglichkeiten haben als weniger. Aber ich gebe gern zu, dass das in Wirklichkeit nicht immer so ist. Und die Lehrenden sehen immer nur den bürokratischen Wust, der da entsteht. Natürlich war es viel einfacher, eine Rahmenprüfungsordnung zu haben, innerhalb derer man dann machen konnte, was man wollte. Der Bologna-Prozess ist zum ersten Mal eine Universitätsreform, der man nicht entgehen kann. Ich habe viele Prüfungsordnungen erlebt, die nichts an meinem Prüfungsverhalten geändert haben, aber diese Reform kann man nicht unterlaufen.
FSR: Also bleibt einem einfach nichts anderes übrig?
Grimm: Man muss sich dem Europäischen Studienmodell stellen. Man kann das ja in tausend Richtungen ausgestalten
FSR: Das ist eine Form von Resignation gegenüber den Prozessen von oben.
Grimm: Nein, es ist einfach eine menschliche Eigenschaft, dass man sich erst in Bewegung setzt, wenn man muss.
FSR: Es gibt Professoren, die sich aufgrund dieser neuen Zwänge nun vollkommen aus der akademischen Welt zurückziehen.
Grimm: Schon wenn man Professor wird, macht man die enttäuschende Entdeckung, dass man ganz andere Dinge machen muss, als man sich das als angehender Wissenschaftler vorgestellt hatte. Man hat eine Unmenge Verwaltung, Selbstverwaltung und dergleichen, aber eine Institution, die Anspruch auf Autonomie erhebt, muss diese Selbstverwaltung eben leisten. Zweitens ist es wohl richtig, dass der Bologna-Prozess in Deutschland besonders deutsch durchgeführt wird, also besonders bürokratisch und kompromisslos. Aber diese Bürokratie gab es auch vorher schon.
FSR: Dann gibt es keine Alternative zur Bürokratie?
Grimm: Doch, indem man die Studienreform selber in die Hand nimmt, und indem man die Chancen des Bologna-Prozesses, etwas Neues zu machen, auch wirklich wahrnimmt. Das beflügelt die eigenen Energien, das bringt neue Studierende, das weckt Interesse für neue Berufsfelder.
FSR: Wenn es diese negativen Seiten schon immer gegeben hat, bedeutet Bologna dann jetzt also die Heilung des Status Quo oder doch nur die Institutionalisierung der Misere?
Grimm: Mein Idealbild wäre, dass die Universität ihre Aufgaben auf differenzierte Weise wahrnimmt. Dass es Bakkalaureus-Studiengänge gibt, als vollwertiges Studium, nicht nur als Grundstudium. Dass wir entbürokratisieren, wie es ja der Akkreditierungsrat zur Zeit schon macht, dass der Bakkalaureus kein Kurzstudium ist, sondern volle drei, meinetwegen auch vier Jahre gehen darf, je nach Studienziel. Dass die Studienwünsche dieser Studierenden erfüllt werden. Dass es eine sicher kleinere Zahl an Studenten gibt, die nach dem B.A. weiterstudieren, entweder hin zur Spezialisierung oder in einer wissenschaftlichen Vertiefung. Ich möchte nicht, dass die älteren Professoren in der Master-Studienphase unterrichten und die jüngeren in der Bachelor-Studienphase, sondern genau umgekehrt.
FSR: Ist das nicht nur ein positiver Nebeneffekt eines Prozesses, der ursprünglich mit ganz anderen Zielen begonnen wurde?
Grimm: Die Ziele waren ja nie so ganz klar
FSR: Welches waren denn die Ziele?
Grimm: Da gab es Leute, z.B. in der Europäischen Kommission, die wollten die Fluktuation, also den Wechsel zwischen den europäischen Hochschulen erleichtern. Dann gab es Leute, die dachten vor allem an Studienzeitverkürzung. Dann gab es Leute, die sich eine höhere Berufs-Orientierung versprachen, wie im Deutschen fälschlicherweise das englische „employability“ übersetzt wurde, obwohl Berufsfeld-Orientierung gemeint ist. Es ist ja aber immer so in der Welt und der Politik, dass es verschiedene Motive gibt und in Wirklichkeit etwas durchaus anderes herauskommt. In Hinsicht auf die Beweglichkeit der Studierenden innerhalb der Europäischen Union ist es eher zu größerer Unbeweglichkeit gekommen. Die meisten werden jetzt erst frühestens nach dem Bachelor wechseln.
FSR: Auf welcher Ebene wurde dieser ganze Prozess in Gang gesetzt, wer hat da die grundlegenden Entscheidungen getroffen?
Grimm: Ausgangspunkt war ein Beschluss der europäischen Wissenschaftsminister. Mit diesem Beschluss von oben setzte sich dann die Hochschulrektorenkonferenz massiv für den Bologna-Prozess ein, zunächst aber ohne Rücksprache mit den Fächern.
FSR: Die Fächer haben sich nun abgefunden.
Grimm: Das funktioniert ja alles nicht, wenn die Betroffenen nicht mitmachen. Deshalb gibt es ja jetzt das Akkreditierungssystem. Akkreditierung ist nun wirklich keine Sache mehr von oben. An unserer eigenen Universität hat sich die Philosophische Fakultät relativ spät entschieden, in den Bologna-Prozess einzusteigen. Im Oktober wird es ein Akkreditierungsverfahren geben: Nicht durch universitätsferne ›Obrigkeiten‹, sondern durch Kollegen von anderen Universitäten, und zwar solchen, die nicht in unmittelbarer Konkurrenz zu uns stehen. Außerdem durch künftige Arbeitgeber und Studierende. Das ist zwar eine Art Kontrolle, aber in dem Sinn, dass man darlegen muss, dass Studiengänge so funktionieren können und dass man sich dafür einsetzt. Die Umsetzung beschließt nicht das Ministerium oder die Universitätsleitung, sondern die Fächer müssen es selber machen.
Aber der eigentliche Punkt am Bologna-Prozess ist ja etwas ganz Schlichtes, das habe ich auch relativ spät bemerkt. Die Universitäten in deutschsprachigen Ländern beschwören immer die Humboldtsche Universitätsreform, deren Kern darin besteht, dass Forschung und Lehre nicht getrennt werden dürfen und dass die Lehre einen Bezug zur aktuellen Forschung haben muss. Der Bologna-Prozess stellt dies nicht in Frage, versteht aber Studiengänge nicht als Emanation einer wissenschaftlichen Disziplin, sondern als verantwortungsvolle Verbindung von Inhalten, die über eine Fachdisziplin hinausgehen. Sie sind also nicht die Privatangelegenheit eines Romanisten z.B., der das macht, was er ohnehin gerne macht, sondern müssen auch noch andere Kriterien erfüllen.
FSR: Warum gibt es kein Alternativkonzept zum amerikanischen Hochschulsystem?
Grimm: Das habe ich auch mal gesagt, aber das ist ein perspektivischer Irrtum. In Wirklichkeit ist der Bologna-Prozess etwas ganz Neues. Jedenfalls etwas anderes als die Übernahme des amerikanischen Studiensystems. Der Irrtum kommt vielleicht daher, dass man einfach die englischen Begriffe Bachelor und Master übernommen hat, aber es trifft nicht zu, dass einfach etwas Angelsächsisches übernommen wurde. Der größte Unterschied bleibt der, dass die europäischen Hochschulen nach wie vor staatlich bleiben. Das sind keine amerikanischen Verhältnisse.
FSR: Noch nicht.
Grimm: Das werden sie auch nicht. Da müsste man viel mehr Geld investieren. Übrigens, der größte Teil der amerikanischen Universitäten, die, welche nicht von unseren Politikern besucht werden, sind weit unter dem Niveau einer normalen deutschen Provinz-Universität. Man darf nicht nur an Harvard und Stanford denken.
FSR: Womit wir beim Thema Eliteuniversität wären.
Grimm: Das ist auch so ein missverständlicher Begriff. Eine Eliteuniversität kann es natürlich nicht geben. Es mag Teile einer Universität geben, die im Augenblick besonders gut sind, das wechselt aber immer, bleibt nie gleich. Ich finde es auch nicht schlecht, dass Universitäten oder Bereiche, die nachweislich und unabhängig bestätigt im einen oder anderen Bereich besonders gut sind, finanziell gefördert werden. Aber die Vorstellung einzelner, für immer feststehender Eliteuniversitäten halte ich für unrealistisch. Wettbewerb zwischen Universitäten ist nicht schlecht, aber bitte nicht nach ökonomischen Maßstäben. Eher stelle ich mir verschiedene Profilbildungen vor, die Universitäten unterscheidbar machen. Darin besteht ja auch das Prinzip von Bologna, dass europäische Universitäten nicht gleich, aber vergleichbar werden, mit gegenseitiger Anerkennung der verschiedenen Leistungen und Studienabschlüsse. Die Romanistik wird dann nirgendwo mehr die gleiche sein, ob in Heidelberg, Jena oder Berlin, aber gleichwertig, jedenfalls im Anrechnungssystem. Daraus könnte ein vielgestaltiger, aber hinreichend integrierter europäischer Hochschulraum entstehen, der auch für Studierende aus Entwicklungsländern oder Asien attraktiv sein kann.
FSR: Aber gerade so etwas wie ein Erasmus-Semester wird durch die Enge im Bachelor erschwert.
Grimm: Das ist ein Problem der Ausgestaltung der Studiengänge. Bachelor-Studiengänge dürfen nicht zu kurz sein und sie müssen hinreichend Zeit lassen, auch ein Auslandsjahr einzuplanen. Es liegt auch an uns, wie wir das ausgestalten. Also: so wenig Reglementation wie möglich! Nicht alle Nebenfächer müssen untergebracht werden, die Professoren für wichtig halten.
FSR: Wenn wir davon ausgehen, dass die im Gange befindliche Modularisierung bereits einen Eindruck der bevorstehenden Studiengänge zulässt, ergibt sich die Frage, ob Zeit, Raum und Auswahlfreiheit, wie sie im bisherigen Magisterstudiengang zur Verfügung standen, weiterhin existieren, ohne sich Vorschreibungen machen lassen zu müssen.
Grimm: Man soll nicht Übungen vorschreiben, sondern Module. Das heißt nur die Modultypen sollen verpflichtend werden, nicht die Studieninhalte. Sie dürfen sich auch nicht von Semester zu Semester wiederholen. Und es muss auch Raum dafür bleiben, dass sich die Studierenden ihr Programm selber zusammenstellen können. Eine sachgerechte Umsetzung des Bologna-Prozesses verlangt somit eigentlich eine Erhöhung der Zahl der Lehrenden.
FSR: Wurden da Fehler bei der Finanzierung gemacht?
Grimm: Das ist nicht nur eine beliebige Universitätsreform, sondern die Reform eines Ausbildungsmodells einer Gesellschaft, in der es sehr viel mehr Studierende geben sollen, als es früher der Fall war. Das verursacht Kosten.
FSR: Wer soll das bezahlen?
Grimm: Die Republik!
FSR: Nicht die Studierenden?
Grimm: Nicht die Studierenden, nein!
FSR: Die Studierenden sind sicher ruhiger als früher, das gesamte Hochschulsystem wird dennoch umgekrempelt und von mehr Autonomie ist die Rede. Sehen Sie Parallelen zu den Errungenschaften von ‘68?
Grimm: Nein, das war etwas völlig anderes. Aber unsere Generation hat elementare Fehler gemacht, z.B. dass sie den Begriff Bildung für ›bürgerlich‹ hielt und zu schnell aufgegeben hat und damit in die technokratische Falle geriet: sie hat Bildung mit Ausbildung verwechselt. Außerdem wurde damals nicht beachtet, dass Universität keine demokratische Veranstaltung ist, sondern eine unvermeidlicherweise hierarchisch strukturierte, die aber kontrolliert werden muss.
FSR: Also ist die ›demokratische‹ Universität illusorisch?
Grimm: Nein, das damalige Verfassungsgerichtsurteil, dass bei Fragen der Wissenschaft im engeren Sinne Entscheidungen nicht ohne eine Professoren-Mehrheit getroffen werden können, die halte ich schon für richtig. Gleichzeitig wurde auch die Beteiligung anderer Universitätsgruppen, wie der Studierenden, verpflichtend.
FSR: Was kann heute von „unten“ kommen?
Grimm: Der Reformprozess funktioniert NUR, wenn etwas von unten kommt.
FSR: Und die Studierenden?
Grimm: Die Studierenden sind zum ersten Mal in die Studiengangsentwicklungen eingebunden. Die Akkreditierungsagenturen arbeiten alle mit studentischen Mitgliedern, dies gilt auch für den Akkreditierungsrat. Im Akkreditierungsrat haben die Bundesländer nur vier Vertreter, das ist ein eindrucksvoller Verzicht für den Staat, der die Hochschulen finanziert. Daneben gibt es Professoren, Studierende, Vertreter der Gewerkschaften, der Arbeitgeber, ausländische Kollegen. Es hat das noch nie gegeben, dass über Studiengänge und über inhaltliche Studienreformen eine solche Vielzahl von Beteiligten mitentscheidet und nicht nur ein Ministerium oder eine Universität. Natürlich gibt es da auch Interessenkonflikte, die zum Ausgleich gebracht werden, aber sie werden nicht kaschiert.
FSR: Und Sie verteidigen die Rolle der Geisteswissenschaften?
Grimm: Nein, das muss ich nicht. Das ist auch so eine verbreitete Vorstellung, die Vertreter der Wirtschaftsverbände hätten etwas gegen Geisteswissenschaften. Das ist überhaupt nicht der Fall. Im Gegenteil. Zwar aus verschiedensten Motiven, aber sie halten Geisteswissenschaften für in der Wirtschaft unentbehrlich. Im Universitätsrat Wien sitzen mehrere Bankchefs, die haben gleich in der ersten Sitzung gesagt, dass kein einziges kleines Fach abgeschafft wird, solange sie im Universitätsrat mitentscheiden.
FSR: Apropos Österreich, was läuft dort anders als in Deutschland?
Grimm. Dort ist man viel weiter. Österreich ist ja ein relativ kleines Land, das früh beschlossen hat, Bologna umzusetzen. Es läuft dort weniger bürokratisch, deshalb hat inzwischen jede österreichische Universität eine andere Struktur. Manche geben sich ein bestimmtes Profil, andere legen sich auf ein breites Fächerspektrum fest. Hier in Deutschland ist die Autonomie der Universität noch lange nicht so weit.
FSR: Was sehen Sie bei uns perspektivisch?
Grimm: Wenn ein Teil der Reformen gelingt, dann kann ich mir vorstellen, dass die Universitätslandschaft in Deutschland bald viel differenzierter aussieht. Dann weiß man, warum man an eine bestimmte Hochschule geht. Ich hoffe auch nach wie vor, dass es zu einer größeren Fluktuation kommt..
FSR: Kommen wir zum eigenen Hause. Was ist dringend zu tun, damit die Romanistik Jena sich selbst weiterhin gerecht wird, auch innerhalb des neuen Studiensystems?
Grimm: Wir befinden uns in einer schwierigen Übergangszeit. Einmal die Umbruchphase durch den Bologna-Prozess und dann auch der Generationenwechsel, denn viele Professoren waren beim Neuaufbau der Romanistik in vergleichbarem Alter und scheiden jetzt aus. Viele Stellen sind derzeit nicht besetzt. Wir haben unser neues Profil noch nicht gefunden. Das muss jetzt mit den Neuberufungen kommen. Alles in allem müssen wir uns in einem möglichst raschen Zeitraum entscheiden, welche Struktur die Romanistik künftig haben soll. Das kann auch nicht in der Romanistik allein geschehen, da muss man sich mit den anderen Geisteswissenschaften zusammensetzen….
FSR: Was könnte die Jenaer Romanistik im deutschen Vergleich zukünftig auszeichnen?
Bisher hat sich die Romanistik Jena dadurch ausgezeichnet, dass sie die Romanistik in ihrer ganzen Breite vertreten hat. Zwar immer relativ schmal von der Personenbesetzung her, aber in der ganzen Breite. Offensichtlich lässt sich das auf die Dauer nicht durchhalten und ist übrigens im Rahmen der Umstellung auf die neuen Studiengänge wahrscheinlich auch nicht möglich. Für die Zukunft wäre ich für eine klare Profil-Entscheidung, aber das entscheide dann nicht mehr ich mit, sondern die nachfolgenden Professoren. Eines scheint mir allerdings gesetzt zu sein; Rumänisch. Und die damit verbundenen Regionalstudien. Hier sind wir in Deutschland die einzigen, das sollte man forcieren und auch ausbauen. In allen anderen Dingen bin ich offen; es muss uns gelingen, neue Kooperationsformen zu finden, traditionelle Themen weiterzuführen, aber auch ganz Neues zu machen. Wir spielen eine noch zu kleine Rolle in gemischten Studiengängen wie IWK. Auch die Idee von Herrn Born, einen Südamerika-Schwerpunkt zu beginnen, war ja keine schlechte Idee.
FSR: Also weg vom traditionellen Fach?
Grimm: Beides. Man muss den Studierenden gerecht werden. Wer Italienisch will, weil er Kunstgeschichte betreibt, muss das können, auch Rumänisch verbunden mit Jurisprudenz muss denkbar sein. Studierende sollen die Ausrichtung ihres Studiums selbst in die Hand nehmen können.
FSR: Aber ein Großteil studiert heute nur mit dem Ziel, später mehr Geld zu verdienen, nicht zur Selbstbildung.
Grimm: Das ist schwer zu sagen, außerdem haben auch dann die Studierenden mehr Chancen, die ungewöhnliche Kombinationen wählen. Sinologie und BWL studieren nicht Tausende.
FSR: Aber die überfüllten traditionellen Diplom-Studiengänge zeigen die Priorität der Studierenden.
Grimm: Studienentscheidungen unterliegen Modetrends. Das hat es immer gegeben. Ich glaube, dass Bologna-Studiengänge mehr Chancen bieten. Niemand weiß von vornherein, was er später dann tatsächlich machen wird. Bei der Wahl des Studiums sollte man sich für Bereiche entscheiden, die einen interessieren.
FSR: Damit werden Sie sicher nicht dem Großteil der Studierenden hier gerecht.
Grimm: Das würde ich ihnen aber unaufhörlich predigen. Übrigens hat selbst die Wirtschaft inzwischen die Geisteswissenschaften schätzen gelernt.
FSR: Hoffentlich hören das alle, damit die Qual jener Kommilitonen durch Überfüllung entsprechender Hörsäle bald ein Ende hat. Aber kurzfristig hilf da wohl nur der NC?
Grimm: Damit sind wir beim Thema Zulassungsbeschränkung. Auch hier bietet Bologna Alternativen. Ich bin dafür, ohne Eingangsbeschränkungen in einer Orientierungsphase des Studiums die Chance zu eröffnen, Studienentscheidungen zu revidieren. Das kann gegen Überfüllung helfen
FSR: Hier zeigen sich doch weiterreichende Probleme. Unter gesellschaftlichem Druck werden von Studierenden Studiengänge gewählt, die eine finanzielle Perspektive bieten. Können sich die Hochschulen so einem gesamtgesellschaftlichen Problem stellen?
Grimm: Die Hochschulen können nicht gesellschaftliche Krisen lösen. Aber sie müssen damit umgehen. Dabei halte ich das Bologna-System für flexibler als das traditionelle Studiensystem, das bestraft nämlich nur, indem es Studierende in einem viel zu späten Stadium sanktioniert. Das ist doch viel irrationaler und ungeeigneter als das Bologna-System, das weniger auf Abschlussexamina als auf studienbegleitende Qualifikation setzt und bei richtiger Umsetzung die Eigenverantwortung der Studierenden stärkt. Ich glaube nicht, dass jemand, der zum dritten Mal ein Pflichtmodul nicht schafft, es zum vierten oder fünften Mal probieren wird.
FSR: Aber zu Ihrer Zeit hat man noch viel länger studiert, z.B. Sie haben vier Fächer studiert, wie auch viele, viele andere Professoren. Teilweise acht oder neun Jahre.
Grimm: Ja, aber Romanistik habe ich zum Beispiel nie studiert. Ich habe Romanistik als Nebenfach in der Promotion gehabt und mich dann in diesem Fach habilitiert, ohne es studiert zu haben. Darum beherrsche ich auch weniger romanische Sprachen als manche Kollegen. Ich kann z.B. Spanisch nur lesen, nicht sprechen.
FSR: Und Rumänisch auch nicht!
Grimm: Nein, und auch kein Portugiesisch. Während andere Kollegen das können, die von Vornherein Romanistik studiert haben. Dafür habe ich andere Qualifikationen aus meinen übrigen Studiengebieten.
FSR: Der Studierende heute bekommt ein Studium, das den gesellschaftlichen Ansprüchen gerecht werden will, nicht mehr dem humanistisch-freien Geist. Es geht um Beruf. Man wird nicht mehr gebildet, sondern ausgebildet an Universitäten.
Grimm: Ich wünsche mir, dass man auch ›gebildet‹ wird. Aber wir können von einer Gesellschaft nicht verlangen, dass sie einem so hohen Prozentsatz an Menschen ›nur‹ zur Bildung, nicht aber zu einer Ausbildung verhilft. Beides muss sich auch nicht ausschließen. Bildung können Sie auch im neuen Studiensystem erwerben.
FSR: Aber nicht unter diesem Zeitdruck.
Grimm: Doch. Man sollte dann den Bachelor relativ früh abschließen, einen innovativen Studiengang wählen und dann im Master-Studium eine Vertiefung anstreben. Da können Sie sich dann etwas mehr Zeit lassen. Aber die verfügbare Zeit ist natürlich auch nicht unendlich!
FSR: Also dient im Grunde der Bologna-Prozess nur dazu, dem Phänomen Massen-Universität gerecht zu werden…
Grimm: ….und dazu, etwas zu retten, was zum Wesen der europäischen Hochschulen gehört …
FSR: … genau, eine kleine Elite hat dann die Möglichkeit, Raum und Zeit zu erhalten, die der Geist braucht, um sich im traditionellen Sinne zu bilden.
Grimm: Nein, möglichst viele Studierende sollen diese Möglichkeit bekommen. Nicht nur eine kleine Elite. Wir sind uns ja einig. Bildung ist ja nicht was für einige wenige.
FSR: Welche Verantwortung trägt die Politik bei diesen Problemen?
Grimm: Erstens sollte die Politik die Hochschulen mehr und mehr aus ihrer direkten Verantwortung entlassen und ihnen mehr Autonomie erlauben, kontrollierte Autonomie wohlgemerkt. Sie soll keine Entscheidungen treffen, die sie eigentlich nicht treffen kann, weil sie gar keine Entscheidungskompetenz hat. Das Akkreditierungssystem ist ein erster Schritt in diese Richtung. Zweitens sollte die gesamte künftige europäische Politik sehr viel mehr Geld in die Ausbildungssysteme stecken, nicht nur in die Universitäten, auch in andere Ausbildungssysteme, das fängt ja alles viel früher an. Drittens sollte sie Freiräume schaffen, um den Lernenden auch die Chance zu geben, zu suchen, sich zu orientieren, in welche Richtung sie gehen wollen.
FSR: Was wünschen oder empfehlen Sie den neuen Studierenden, die nun zum ersten Mal nur noch im neuen BA-/MA-System studieren können?
Grimm: Ich würde ein breit angelegtes BA-Studium machen, also mit einer möglichst breiten Konstellation von Fächern, und mir während des BA-Studiums überlegen, wie ich mich in der nächsten Studien-Etappe, also im Master, dann spezialisiere.
FSR: Aber man kann nur noch zwei Fächer wählen.
Grimm: Vielleicht kann man dann wenigstens zwei sehr unterschiedliche wählen.
FSR: Nun kurz noch zum privaten Reinhold Grimm. Wenn Sie morgen nach Wien fliegen, fällt Ihnen dann auch Thomas Bernhard ein?
Grimm: Ich habe in den ersten Sitzungen des Wiener Universitätsrats immer gesagt, dass ich, seit ich Mitglied dort bin, ununterbrochen Thomas Bernhard lese, weil ich ihn als eine indirekte Liebeserklärung an Österreich empfinde. Damit bin ich aber bei den Kollegen aus der Wirtschaft immer auf eine gewisse Verbitterung gestoßen. Nein, ich liebe den wirklich sehr, den Bernhard.
FSR: Ihr Leben ist inzwischen mit vielen akademischen Ämtern verbunden. Liegt Ihnen das?
Grimm: Ich habe erst relativ spät gemerkt, dass ich für Hochschulpolitik vielleicht geeignet bin, gerade weil ich unverhohlen meine Meinung sage, aber auch bekanntgebe, wenn ich die geändert habe, was ebenso unüblich ist. Ich habe auch gelernt, lange zuzuhören, obwohl ich sonst eher der Typ bin, der explodiert. Dafür habe ich mehrere Bücher nicht geschrieben, die ich gerne geschrieben hätte und von denen ich mir immer noch vormache, dass ich sie irgendwann schreiben werde. Ich habe auch gemerkt, dass nur ganz wenige Menschen die Chance haben, mit sich ablösenden Generationen junger Leute umzugehen, und das finde ich inzwischen wichtiger, als manch Wissenschaftliches, was ich so gemacht habe.
FSR: Nun zu einer Frage, die Thomas Bernhard stellt; ist das Leben eine Tragödie oder eine Komödie?
Grimm: Beides. Der Unterschied ist ganz gering zwischen einer Tragödie und einer Komödie. Das kann ich mit einem Molière erklären, den man tragisch und komisch inszenieren kann, und beides ist wahr. Institutionen sind teilweise überaus komisch. Das schließt aber nicht aus, dass sie durchaus ernsthafte Sachen betreiben.
FSR: Welche Werke der Literatur haben Ihr Leben beeinflusst?
Grimm: Das wechselte. Zu meiner Zeit als Privatdozent in Konstanz teilte ich meinen Studierenden mit, sie seien erst Menschen, wenn sie Proust ganz gelesen hätten. Und in Hannover habe ich als Professor einen Anruf von jemandem bekommen, mit dem ich nie gerechnet hätte. Er teilte mir am Telefon mit, er sei jetzt Mensch geworden. Aber was mich selber angeht, waren das Kant und Hegel. Proust gehört auch dazu. Aber ich glaube, das wechselt. Wenn man länger nachdenkt, fallen einem viele Bücher ein. Aber auf diese „einsame Insel“ zum Beispiel, ich bin nicht ganz sicher, ob man nicht auch Don Quijote mitnehmen könnte.
FSR: Haben Sie Zeit zu lesen?
Grimm: Ich lese ununterbrochen. Abends vorm Einschlafen. Und auf keinen Fall die Sachen, die ich lesen muss. Immer mehrere Sachen gleichzeitig. Ich lese übrigens auch Kriminalromane. Ich bin ein begeisterter Anhänger davon und bin mir auch vollkommen im Klaren drüber, wie einfach die gestrickt sind, das macht aber nichts. Aber es gibt auch Texte, die ich immer wieder gelesen habe. Goethes Wahlverwandtschaften zum Beispiel. Und dann macht man die Entdeckung, man habe etwas überlesen, aber in Wirklichkeit hat man inzwischen eine andere Perspektive. Das macht mich auch sehr vorsichtig. Man wird mit dem Alter auch wählerischer, wenn man bedenkt, dass man manches vielleicht zum letzten Mal liest. Aber ich kann mir nicht vorstellen, nicht zu lesen. Ich halte es ganz ehrlich sogar für irrelevant, was man liest. Wichtig ist, dass man liest. Dass ich als Professor natürlich versuche, einen Teil der abendländischen Tradition zu retten, ist klar. Ich finde es aber bei Magisterarbeiten zum Beispiel immer am besten, wenn der Studierende etwas Eigenes vorschlägt. Auch wenn mir ein Autor nicht passt. Das ist besser als die hundertste Arbeit über Molière.
FSR: Sie sagten, Sie würden etwas schreiben wollen. Was wäre das? Wissenschaftliches oder Belletristik?
Grimm. Nein, Belletristik habe ich nie gemacht. Ich würde gerne mit meiner Frau ein Buch über die Funktion von Mythos und Religion in der frühen Neuzeit schreiben. Die These des Buches wäre, dass die elementaren Sinnstiftungskategorien ganz einfach sind und dass mythische und religiöse Motive vollkommen identisch sind. Und gerade mit meiner Frau kann ich gut gemeinsame Texte schreiben; wir kritisieren uns gegenseitig völlig schonungslos.
Die Fachschaft der Romanistik Jena bedankt sich bei Reinhold Grimm für das Interview.